Die SWOT-Analyse ist eine Methode zur Analyse, die sich auf ganz unterschiedliche Beispiele anwenden lässt. Das gilt nicht nur für die Unternehmenswelt, sondern auch für akademische Arbeiten.
Das Kürzel SWOT steht für:
- Strengths (Stärken)
- Weaknesses (Schwächen)
- Opportunities (Chancen)
- Threats (Risiken)
Die Methode betrachtet sowohl die innere Verfasstheit eines Analyseobjekts (also Stärken und Schwächen) als auch dessen äußeres Umfeld (Chancen und Risiken). Dadurch entsteht ein umfassendes Bild – wie eine strategische Landkarte.
SWOT ist nicht nur logisch aufgebaut, sondern auch für wissenschaftliche Arbeiten erstaunlich einfach anzuwenden.
Warum SWOT in Abschlussarbeiten glänzt
Bachelor- und Masterarbeiten verlangen mehr als bloße Beschreibung. Analytisches Denken, Struktur und fundierte Schlussfolgerungen sind gefragt. Genau hier spielt die SWOT-Analyse ihre Stärken aus:
- Sie hilft, komplexe Zusammenhänge greifbar zu machen.
- Sie unterstützt dabei, Wechselwirkungen zwischen Faktoren sichtbar zu machen.
- Sie bietet eine klare Grundlage für Handlungsempfehlungen.
Im Folgenden wird erläutert, wie die SWOT-Analyse funktioniert:
- Ziel und Fokus festlegen
Bevor es losgeht, wird geklärt, was analysiert werden soll: eine Organisation? Ein Programm? Ein gesellschaftlicher Trend? Je konkreter der Analysegegenstand, desto schärfer wird der Blick auf die relevanten Faktoren.
- Innenschau: Stärken und Schwächen erkennen
Jetzt geht’s ans Eingemachte. Welche Ressourcen, Kompetenzen und Besonderheiten bringt der Untersuchungsgegenstand mit? Nehmen wir an, wir analysieren ein Unternehmen.
Typische Stärken:
• Motiviertes Team
• Klare Strukturen
• Positive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit
• Langjährige Erfahrung
• Ein Alleinstellungsmerkmal in Form von innovativen Produkten
Typische Schwächen:
• Knappe Ressourcen (kleine Unternehmen haben ein niedrigeres Budget als Großkonzerne, weniger Mitarbeitende / Fachkräftemangel)
• Veraltete Technik (Anschluss an die Digitalisierung verpasst?)
• Geringe Bekanntheit (und ein kleines Werbebudget – siehe knappe Ressourcen)
Ehrlichkeit ist hier der Schlüssel – nur so wird die Analyse zur belastbaren Grundlage.
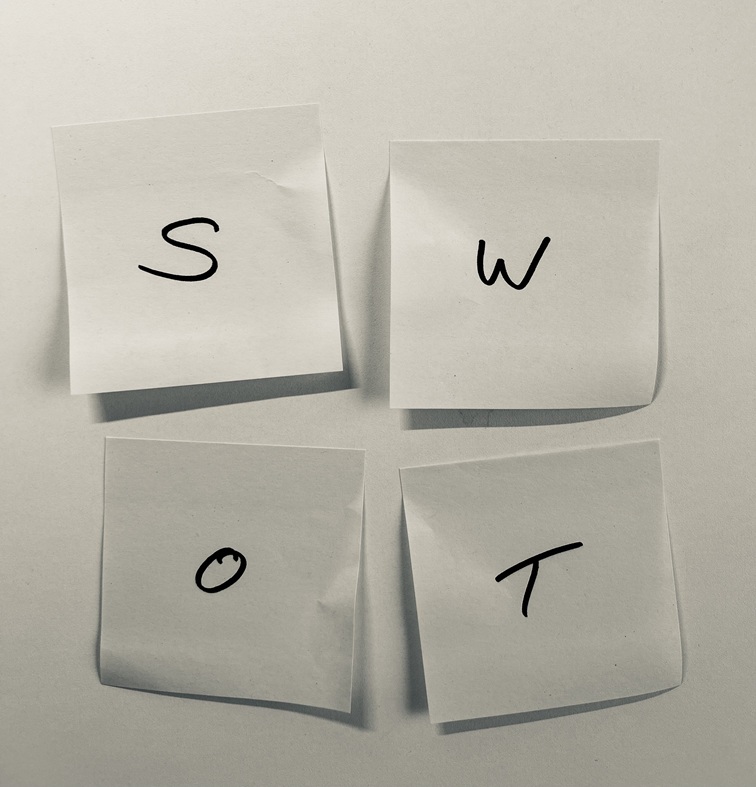
- Blick nach außen: Chancen und Risiken erkennen
Welche externen Entwicklungen spielen eine Rolle? Was könnte unterstützen, was könnte gefährlich werden?
Typische Chancen:
- Neue Förderprogramme
- Gesellschaftlicher Wandel
- Technologische Innovationen
Typische Risiken:
- Konkurrenzdruck
- Gesetzesänderungen
- Wirtschaftliche Unsicherheiten
- Alles auf einen Blick: Die SWOT-Matrix
Die SWOT-Matrix fasst die Ergebnisse übersichtlich in einer Tabelle zusammen:
|
Diese Darstellung ist nicht nur optisch ein Gewinn – sie zeigt auf einen Blick, wo es hakt und wo Potenzial liegt.
- Strategien entwickeln – mit System
Jetzt wird’s strategisch: Aus der Matrix lassen sich gezielte Maßnahmen ableiten. Dabei helfen vier klassische Kombinationen:
- SO-Strategien (Strenghts & Opportunities): Stärken nutzen, um Chancen zu ergreifen
- WO-Strategien (Weaknesses & Opportunities): Schwächen abbauen, um Chancen zu nutzen
- ST-Strategien (Strenghts & Threads): Stärken einsetzen, um Risiken abzufedern
- WT-Strategien (Weaknesses & Threads): Risiken minimieren und Schwächen reduzieren
Gerade im Fazit einer wissenschaftlichen Arbeit können solche strategischen Ansätze einen echten Mehrwert liefern.
